

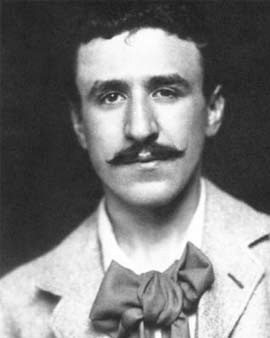
Wie viele Künstler des Jugendstils strebte Charles Rennie Mackintosh nach einem universellen Design, das sich auf Architektur, Inneneinrichtung und Gebrauchsgegenstände, also quasi auf das gesamte alltägliche Leben bezog. So entwarf er neben Häusern verschiedenste Möbel, musterte Vorhänge, ließ Besteck und Metall formen, skizzierte Bucheinbände und beschäftigte sich mit einer großen Bandbreite an anderen kunstgewerblichen Gütern. Daneben fertigte er auch Blumenstudien, Ornament- und Architekturskizzen oder Landschaftsansichten an.
Er war prägend für die Architekturszene in Glasgow, beeinflusste mit seinem Schwarz-Weiß-Stil maßgeblich die Wiener Sezession und die Wiener Werkstätten ebenso wie die deutschen Produktionsstätten in Hellerau. Dort entwickelte innovative und neue Wohnkonzepte strahlten bis in das Bauhaus nach und legten den Grundstein für die moderne Möbelgestaltung, wie wir sie bis heute kennen und schätzen. Maßgeblich war an Mackintoshs Ideen und Konzepten immer auch seine Frau Margaret MacDonald beteiligt, die selbst künstlerisch tätig in Erscheinung trat. Mackintosh wiederum war geprägt worden von den gärtnerischen Ambitionen seines Vaters und ließ gerne eine stilisierte Rose oder andere florale Elemente in seine Arbeiten einfließen. Daneben beeinflussten ihn die keltischen Ursprünge Schottlands ebenso wie japanische Kunstwerke, was sich in einer geometrischen Gestaltung, einer gewissen Schlichtheit und einer symbolischen Formensprache niederschlug. Besonders hervorzuheben ist sein Entwurf und die Umsetzung der Glasgow School of Art, die bis heute als das Meisterstück von Charles Rennie Mackintosh angesehen wird und das trotz einer beginnenden Alkoholabhängigkeit ihres Architekten. Hier ist besonders die Ausgestaltung der Bibliothek hervorzuheben. Auch für den Entwurf und die Umsetzung von vier Salons in Glasgow entbehrte es nicht einer gewissen Ironie, dass Mackintosh ein erhebliches Alkoholproblem hatte, da die Auftraggeberin als Angehörige der Anti-Alkohol-Liga das enthusiastische Ziel verfolgte, im trinkfreudigen Schottland einen Treffpunkt für Teetrinker zu schaffen und der Ausschank von Alkohol in ihren Teesalons definitiv nicht vorgesehen war.
Nicht weniger verständlich, aber umso tragischer ist es, dass Mackintoshs berühmte Stühle mit den hohen Lehnen heute als Designklassiker angesehen werden, während der Künstler selbst Zeit seines Lebens mit seinen Entwürfen nicht wirklich viel Geld verdienen konnte und sogar mit seiner Frau einen Umzug vom quirligen London in die Abgeschiedenheit der französischen Pyrenäen vollzog, um an den Lebenshaltungskosten sparen zu können. Er starb aufgrund eines diagnostizierten Zungenkrebses quasi mittellos nach einer verzweifelten Rückkehr in London, wo sein Nachlass nach dem Tod seiner Frau einige Jahre später sogar als komplett wertlos erachtet wurde. Möglicherweise stand er sich mit seinem Alkoholproblem selbst im Weg, was das Akquirieren neuer und lukrativer Aufträge betraf. Denn seine Arbeiten wurden von vielen Zeitgenossen und Künstlern hochgeschätzt und gelobt. Sie sind heute weltweit anerkannt, sodass es nicht mangelnder Qualität oder einem fehlenden Talent zugeschrieben werden kann, wenn die berufliche Etablierung Mackintoshs nicht so erfolgreich verlief, wie die von künstlerisch weit weniger ambitionierten Zeitgenossen.
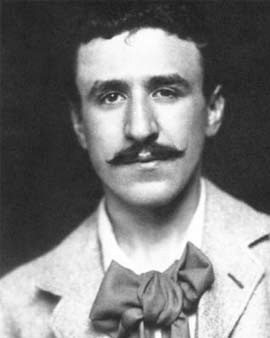
Wie viele Künstler des Jugendstils strebte Charles Rennie Mackintosh nach einem universellen Design, das sich auf Architektur, Inneneinrichtung und Gebrauchsgegenstände, also quasi auf das gesamte alltägliche Leben bezog. So entwarf er neben Häusern verschiedenste Möbel, musterte Vorhänge, ließ Besteck und Metall formen, skizzierte Bucheinbände und beschäftigte sich mit einer großen Bandbreite an anderen kunstgewerblichen Gütern. Daneben fertigte er auch Blumenstudien, Ornament- und Architekturskizzen oder Landschaftsansichten an.
Er war prägend für die Architekturszene in Glasgow, beeinflusste mit seinem Schwarz-Weiß-Stil maßgeblich die Wiener Sezession und die Wiener Werkstätten ebenso wie die deutschen Produktionsstätten in Hellerau. Dort entwickelte innovative und neue Wohnkonzepte strahlten bis in das Bauhaus nach und legten den Grundstein für die moderne Möbelgestaltung, wie wir sie bis heute kennen und schätzen. Maßgeblich war an Mackintoshs Ideen und Konzepten immer auch seine Frau Margaret MacDonald beteiligt, die selbst künstlerisch tätig in Erscheinung trat. Mackintosh wiederum war geprägt worden von den gärtnerischen Ambitionen seines Vaters und ließ gerne eine stilisierte Rose oder andere florale Elemente in seine Arbeiten einfließen. Daneben beeinflussten ihn die keltischen Ursprünge Schottlands ebenso wie japanische Kunstwerke, was sich in einer geometrischen Gestaltung, einer gewissen Schlichtheit und einer symbolischen Formensprache niederschlug. Besonders hervorzuheben ist sein Entwurf und die Umsetzung der Glasgow School of Art, die bis heute als das Meisterstück von Charles Rennie Mackintosh angesehen wird und das trotz einer beginnenden Alkoholabhängigkeit ihres Architekten. Hier ist besonders die Ausgestaltung der Bibliothek hervorzuheben. Auch für den Entwurf und die Umsetzung von vier Salons in Glasgow entbehrte es nicht einer gewissen Ironie, dass Mackintosh ein erhebliches Alkoholproblem hatte, da die Auftraggeberin als Angehörige der Anti-Alkohol-Liga das enthusiastische Ziel verfolgte, im trinkfreudigen Schottland einen Treffpunkt für Teetrinker zu schaffen und der Ausschank von Alkohol in ihren Teesalons definitiv nicht vorgesehen war.
Nicht weniger verständlich, aber umso tragischer ist es, dass Mackintoshs berühmte Stühle mit den hohen Lehnen heute als Designklassiker angesehen werden, während der Künstler selbst Zeit seines Lebens mit seinen Entwürfen nicht wirklich viel Geld verdienen konnte und sogar mit seiner Frau einen Umzug vom quirligen London in die Abgeschiedenheit der französischen Pyrenäen vollzog, um an den Lebenshaltungskosten sparen zu können. Er starb aufgrund eines diagnostizierten Zungenkrebses quasi mittellos nach einer verzweifelten Rückkehr in London, wo sein Nachlass nach dem Tod seiner Frau einige Jahre später sogar als komplett wertlos erachtet wurde. Möglicherweise stand er sich mit seinem Alkoholproblem selbst im Weg, was das Akquirieren neuer und lukrativer Aufträge betraf. Denn seine Arbeiten wurden von vielen Zeitgenossen und Künstlern hochgeschätzt und gelobt. Sie sind heute weltweit anerkannt, sodass es nicht mangelnder Qualität oder einem fehlenden Talent zugeschrieben werden kann, wenn die berufliche Etablierung Mackintoshs nicht so erfolgreich verlief, wie die von künstlerisch weit weniger ambitionierten Zeitgenossen.
Seite 1 / 3






